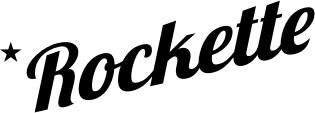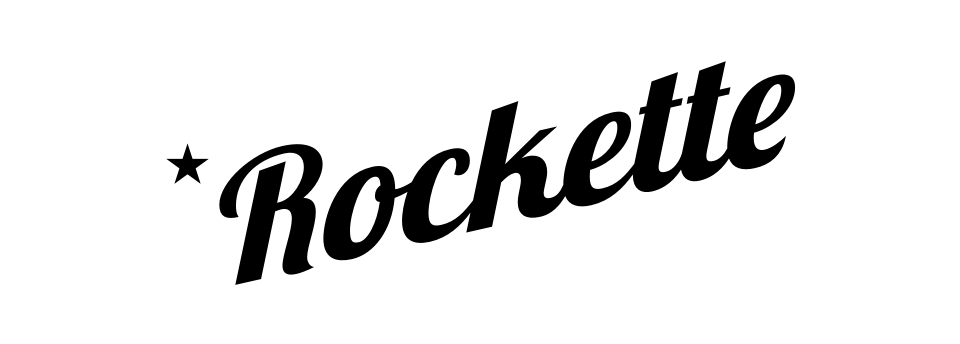“Die Kinder hören Pink Floyd” und wir gleich mit: Alexander Gorkow, Co-Kulturchef bei der SZ, hat einen berauschenden Roman geschrieben. Bitte lest ihn, selbst wenn ihr die 70er-Jahre nicht erlebt haben solltet.
Es gibt ja Schriftsteller, die sich selber befriedigen beim Schreiben. Das ist unbedingt im übertragenen Sinne zu verstehen! Es sind Männer, die mit Sprache derart gut umgehen können, dass man als Leser*in zu jeder Zeit leicht fiebrig oder schwer erregt die Seiten umblättert. Was sie natürlich wissen, diese Männer, mehr noch, ihre Zeilen erwecken den Eindruck, dass sie ihre Worte selber auch sehr geniessen – und das macht das Ganze noch viel sexier.
So ein Autor ist Alexander Gorkow. Zumindest in seinem autobiografischen Roman “Die Kinder hören Pink Floyd” (die beiden anderen habe ich – noch – nicht gelesen), der in den 70er-Jahren in der Düsseldorfer Vorstadt spielt. Sex ist nur am Rande ein Thema, der junge Gorkow ist erst um die zehn. Seine Welt besteht aus gepflegten Gärten, Einbauküchen und der kranken grossen Schwester.
Und Pink Floyd. Schwester und Bruder vergöttern die Band im fernen London.
Es geht um deren Plattencover und Musik, es geht um Heino (“Ist Heino ein F-faschist?” “Er ist kein Faschist. Er ist ein Idiot.”); um den Widersacher des stotternden Ich-Erzählers, Richard le Bron, und um einen Film namens “Die Nacht der reitenden Leichen”.
Es ist so: Alle Kinder der Siebziger werden sich freudig wiedererkennen. Und folglich nicht zusammenzucken, wenn die Rede ist von Gorkows Gspänli Hubi, der “ein Mongo” ist, “wie man sagte”. Wie auch der Satz über Heino ist die Beschreibung von Hubi aus dem Zusammenhang gerissen, aber wenn ich hier alle gelungenen Passagen aufführen würde, schriebe ich das ganze Buch ab, und hätte dann wohl ein Problem mit Urheberrechten.
Wenn sich übrigens Rockette Miriam fragt, ob sie im Scratchbook von Nick Cave wohnen möchte – ich habe bei Gorkow gelebt (wenn auch ein paar Jahre später und mit anderer Musik). Und um Musik dreht sich die Geschichte oft, im Speziellen um Pink Floyd. Die Schwester etwa weint bei “Wish You Were Here”, weil es so schön ist, und sie schickt der Band viele Briefe nach London. Der Vater flippt aus “beim Riss” – einem Effekt – nach 4 Minuten und 52 Sekunden im Song “Have A Cigar”.
Auf dem Klappentext ist ein Jörg Thadeusz von WDR2 zitiert, er schreibt unter anderem, “Wenn man das Buch bis zum letzten Satz liest, sitzt man da und ertappt sich selbst beim Weinen.” Was stimmt, ich habe mir Tränen fortgewischt. Aber vorher eben auch sehr gelacht. Und den Atem angehalten. Und geseufzt.
Was man eben so macht, wenn man erregt ist.
 Alexander Gorkow: “Die Kinder hören Pink Floyd”, 192 S., Kiepenheuer & Witsch, Fr. 28.90, hier erhältlich.
Alexander Gorkow: “Die Kinder hören Pink Floyd”, 192 S., Kiepenheuer & Witsch, Fr. 28.90, hier erhältlich.